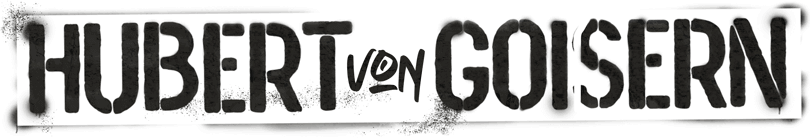FLÜCHTIG
Barbara Karlich Buchklub mit Hubert von Goisern
Haltung zeigen, Geduld bewahren
O-Töne Literaturfestival in Wien
Im Gespräch mit Hubert von Goisern
Eigentlich sollte Hubert Achleitner, besser bekannt als Hubert von Goisern, seinen ersten Roman bewerben.
Aber über die eigene Arbeit zu reden, hatte er keine Lust. Ein Gespräch über alles andere.
Herr Achleitner, würden Sie heute Ihren Hit Koa Hiatamadl noch aufnehmen?
Natürlich, das ist noch immer eine geile Nummer. Ich merke auch heute noch, wenn ich sie höre, welchen Wumms die hat.
Es ist ein sexistischer Text.
Es geht um das Sehnen der Männer in den Bergen nach einer Frau, die etwas mehr Fleisch an den Wadeln hat. Die nicht so drahtig ist wie die, die sie aus ihren Dörfern kennen. Es ist eher ein Plädoyer gegen Magersüchtige.
So ein Lied würde Ihnen heute einen Shitstorm bescheren.
Die Leute regen sich heute wegen allen Nebensächlichkeiten auf. Kürzlich wurde ich in einem Interview mit dem Standard gefragt, was ich von der Corona-Krisen-Politik von Sebastian Kurz halte. Ich sagte, er macht sich ganz gut. Das wurde dann zur Überschrift – und ich bekam einen Shitstorm ab.
Es scheint uns, als würden Sie es genießen, sich gegen den Mainstream zu stellen.
Alles andere wäre mir zu langweilig. Wenn man gegen den Strom schwimmt, sieht es zwar vom Ufer wie Stillstand aus. Aber in Wahrheit trainiert es die Muskeln.
Damit machen Sie sich keine Freunde. In Österreich stürzte eine Staatssekretärin, weil sich die Kulturbranche von ihr in der Corona-Krise im Stich gelassen fühlte. Sie hingegen sagten, Sie hätten diese ruhige Zeit genossen: "Vielleicht hört jetzt auch mal das ewige Bussi-Bussi-Geben auf."
Ja, für mich war der Zeitpunkt ganz günstig. Ich habe in den vergangenen Monaten die Musik, die wir von November bis Jänner aufgenommen haben, gemischt und geschnitten. Da ist man am liebsten allein. Und diesmal kam nicht ständig wer vorbei und wollte schon etwas hören.
Was ist daran toll, wenn sich die Menschen auf sich selbst und in ihr engstes Umfeld zurückziehen?
Zu Beginn wurden die Leute freundlicher. Selbst solche, die sonst ziemliche Grantler sind, waren plötzlich netter. Jetzt aber sind langsam alle wieder etwas gestresst, weil sie sich in der neuen Normalität zurechtfinden müssen. Ich hatte immer etwas zu tun, erst habe ich die Musik fertig gemacht, und die vergangenen Wochen waren PR-Termine und Interviews. Heute ist der letzte Tag, darüber bin ich ganz froh.
Wieso das?
Ich spreche nicht gerne über meine Arbeit. Ein Buch oder ein Album, die müssen für sich sprechen. Wenn man das noch erklären muss, dann stimmt etwas nicht.
Stellen wir so doofe Fragen?
Wenn wir über Dinge sprechen, die aktuell sind, die uns alle betreffen, das gefällt mir.
Mögen Sie eigentlich Ihre Fans?
Ja, schon. Aber als ich die ersten Auftritte hatte, habe ich immer wieder Leute aus meinen Konzerten werfen lassen.
Warum?
Weil sie gestört haben. Ich stand da in Bierzelten auf der Bühne. Manche im Publikum wollten einfach nur Party machen, ich aber ein Konzert geben – und das ist meine Veranstaltung, ich bestimme, wie die abläuft. Es gab Abende, da habe ich das Konzert für 20 Minuten unterbrochen und bin erst dann wieder auf die Bühne, wenn ein bestimmter Teil des Publikums weg war.
Haben Sie die mit Ihrer Musik einfach vergrault oder so richtig vom Sicherheitsdienst rauswerfen lassen?
Genau so. (lacht) Sie haben aber immer das Geld für ihre Karten zurückbekommen.
Kommen denn heute die richtigen Leute an Ihre Konzerte?
Wie meinen Sie das?
Dulden Sie zum Beispiel die Fans des heimattümelnden, österreichischen Volksmusik-Stars Andreas Gabalier an Ihren Konzerten?
Wie soll ich die denn erkennen?
Gibt es in Ihrem Publikum Überschneidungen mit dem von Andreas Gabalier?
Ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die zu Konzerten von uns beiden gehen.
Können Sie sich seinen Erfolg erklären?
Muss ich das?
Also fragen wir anders: Heute boomen Landlust-Magazine, in hippen Wiener Bezirken wird handgeknetetes Brot aus dem Waldviertel verkauft, und in der Schweiz werden Schwingfeste live im Fernsehen übertragen. Woher kommt dieser rurale Retro-Kult?
Dass eine Gegenbewegung zur Globalisierung kommt, in der man sich wieder mehr auf das Regionale besinnt, wundert mich nicht. Wie kann es sein, dass Transportwege fast nichts kosten, dass also ein Mohrenbräu-Bier aus Vorarlberg in Wien gleich viel kostet wie ein lokales Ottakringer? Das müsste alles bis zum ökologischen Preis des Transports in die Kosten einfließen. Es braucht auch eine Finanztransaktionssteuer, und selbst Zölle kann ich mir wieder vorstellen.
Auch in der EU?
Warum soll das ein Tabu sein?
Der Retro-Kult ist allerdings vorwiegend ein städtisches Phänomen. Wird das Landleben dabei nicht schrecklich romantisiert?
Natürlich wird es das. Am Land zu leben kann richtig hart sein. Ich kenne viele Bauern, die arbeiten ständig, sieben Tage die Woche. Oder jetzt die Debatte um den Wolf. Da haben Städter so idyllische Vorstellungen von wilden Tieren, die durch den Wald streifen. Aber für die, die davon betroffen sind, ist das nicht so einfach.
Wo stehen Sie in der Debatte um den Wolf? Sind Sie Team Schaf oder Team Wildtier?
Ich habe mit meinen Kindern in Goisern gewohnt, im letzten Haus am Waldrand. Damals war das Thema der Bär, der da lebt. Das war schon ein mulmiges Gefühl. Und auch beim Wolf finde ich nicht, dass das so einfach ist: Man kann nicht Schafe und Menschen hinter Zäune sperren, nur damit der Wolf seinen Freiraum hat. Ich finde, dass man den Wolf, wenn er zum Problem wird, sollte schießen dürfen.
Sie selber verbinden in Ihrem Schaffen die Stadt- und die Landwelt. Sie mischen Volks- mit Popmusik, die Heimat und die Welt. Wie schafft man das, ohne dabei in den national-patriotischen Kitsch zu kippen?
Als ich mit meiner Musik anfing, war ich schon Ende 30, hatte bereits viel gesehen, bin viel in der Welt herumgekommen. Das war sicher ein Vorteil.
Es gibt eine Szene aus einer Fernsehsendung aus den 1990er-Jahren, da gehen Sie in Goisern in ein Wirtshaus, dort sitzt die Musikkapelle, und Sie werden für Ihre Musik und die Bühnenauftritte ziemlich angefeindet. Sie würden herumhüpfen, Elemente aus der Volksmusik klauen und so verpacken, dass sie einem breiten Publikum gefallen. Hat Ihnen die Auseinandersetzung gefallen?
Nein, überhaupt nicht, ich habe das gehasst und darunter gelitten. Der Bayerische Rundfunk wollte, dass ich da hingehe, die haben mich fast dazu gezwungen. Hätte ich Nein gesagt, hätte es gewirkt, als wollte ich mich drücken. Am Vorabend wurde ich krank, das war sicher psychosomatisch. Das war aber vielleicht von Vorteil, dass ich nicht voll im Saft war, denn sonst wäre das in einen handfesten Streit ausgeartet. Das war aber auch ein Vollidiot! Diese Typen sind aber alle inzwischen gestorben, das Problem hat sich also von selbst erledigt.
Wie viel Kraft brauchten Sie, um sich gegen die Konventionen zu stellen?
Das ist mir eigentlich immer leichtgefallen. Goisern hat mich ausgespuckt wie später auch Wien. Es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste mich freikämpfen.
Der verstorbene FPÖ-Chef Jörg Haider stammt aus dem selben Ort wie Sie. In den Neunzigerjahren haben Sie auf Konzerten gegen ihn gewettert. Mittlerweile war die FPÖ zweimal in der Regierung. Können Künstler politisch überhaupt etwas bewegen?
Das weiß ich nicht. Mir war aber immer wichtig, dass man weiß, wo ich stehe. Ich kann es nicht verhindern, dass bei Veranstaltungen der FPÖ meine Musik gespielt wird ...
... Sie haben deshalb auch mal dem damaligen FPÖ-Chef und späteren Vizekanzler H. C. Strache einen Brief geschrieben.
Ja, dem habe ich geschrieben, damit er weiß, was ich von seiner Politik halte.
Wenn Ihre Lieder bei den liberalen Neos gespielt worden wären, hätten Sie kein Problem gehabt?
Nein, aber Sie fragen mich jetzt bestimmt, wo denn die Grenze für mich wäre?
Genau.
Dass eine FPÖ meine Lieder spielt, dagegen kann ich nicht vorgehen. Aber wenn sie es schon tun, sollen sie wissen, wo ich politisch stehe, dann geht das vielleicht auch in die Köpfe dieser Leute rein, wenn sie meine Musik hören.
Herr Achleitner, Sie machen seit 30 Jahren erfolgreich Musik, waren in den Charts, spielten weltweit Konzerte, haben ein ganzes Genre modernisiert, jetzt erscheint wieder ein neues Album: Zeiten und Zeichen, es Ihr fünfzehntes. Warum mussten Sie mit bald 70 noch ein Buch schreiben?
Weil ich schon lange der Meinung war, dass ich das kann.
Okay.
Es gibt doch diesen Monty-Python-Sketch aus dem Film The Meaning of Life. Da leben auf der einen Straßenseite die Katholen und kriegen ein Kind ums andere. Auf der anderen Seite lebt ein protestantisches, kinderloses Paar, und der Mann sagt zur Frau: Es reicht schon zu wissen, dass wir es könnten. Das reichte mir bei meinem Roman-Projekt irgendwann nicht mehr.
Wieso dauerte es so lange, bis Sie sich ans Schreiben wagten?
In der Schule sagten mir die Lehrer, ich würde nie richtig mit Sprache umgehen können. Ich glaubte ihnen. Deshalb begann ich erst spät, da war ich schon 27 Jahre alt, Bücher zu lesen, weil ich wollte und nicht, weil ich musste. Aber ich las immer mehr Bücher, bei denen ich dachte: Das hätte ich besser gekonnt. Zu viele Autoren können zwar schön schreiben, haben aber nichts zu sagen, oder sie haben etwas zu sagen, können aber nicht schreiben.
Lesen Sie eigentlich Ihre Kritiken?
Ich versuche, es zu vermeiden, allerdings erhalte ich immer wieder welche zugeschickt. Aber wenn ich so darüber nachdenke, fällt mir auf: Es sind ausschließlich die guten. Mein Umfeld will mich schonen.
Würden Sie schlechte Kritik nicht ertragen?
Gute Kritiken machen eitel, schlechte Kritiken schmerzen.
Welcher Verriss hat am meisten geschmerzt?
Der erste, der erschien Ende der Achtzigerjahre, Anfang der Neunziger in den Salzburger Nachrichten. Der Autor schrieb, ich hätte den Menschen am Land das Letzte genommen, was sie noch hätten: ihre Musik. Und gleichzeitig schrieb er, dem Publikum, das damals in Salzburg mein Konzert besuchte, fehle es an Geschmack.
Wie haben Sie darauf reagiert?
Ich bin in die Ressortleiter-Runde der Salzburger Nachrichten gestürmt, habe mir den Autor, sein Name ist mir entfallen, vorgeknöpft, ihm seine Borniertheit vorgeworfen und bin gegangen, bevor er sich wehren konnte.
Wie bitte?
(lacht) Keine Angst, heute würde ich das nicht mehr tun.
Hubert Achleitner: flüchtig
Wer hätte das gedacht? Hubert Achleitner, primär bekannt als Hubert von Goisern, legt sein prosaisches Erstling vor und erzählt in furioser Manier, einem gedankenverlorenen Streifzug durch Gemütsstimmungen Zeiten und Orte gleich, stilsicher und literarisch reif wie ein Autor nach seinem x-ten Roman, aus der Sicht einer Frau. flüchtig ist packend geschrieben und der Neo-Autor schafft es tatsächlich von der ersten Seite an, die Leserschaft in den Bann zu ziehen. Die Melancholie und der Humor, die Leidenschaft und die Enttäuschung, die Vorhersehbarkeit des Lebens und die unvorhergesehenen Etappen (und vice versa), trifft Achleitner mit pointierter Sprache - einer hochdeutschen und strikt ausformulierten Sprache, die in seinem Musikerdasein bisher nur wenig Platz fand. Der Musiker ist in diesem Roman nur insofern wiedererkennbar, wenn er seine Protagonisten über Musik sprechen lässt, meistens flüchtig. ""Wie kommst du auf die Idee, er wäre gestorben?" "So steht es doch auf der Kassette: 'Das war André Heller', und das Bild schaut auch irgendwie aus wie ein Grabmal." "Nein, nein, er ist schon noch am Leben. Er ist halt in Wien sozialisiert, dort gehört der Tod zum Überleben. Vor kurzem hat er eine neue Platte veröffentlicht. Aber diese hier ist seine beste, finde ich jedenfalls."" Oder auch, wenn er über die Nichtmessbarkeit, über den Zauber von Musik, spricht. "Vinyl ist die Orthodoxie unter den Tonträgern, im Gegensatz dazu ist MP3 Atheismus." Um danach einer Schulklasse das erste Album von der Nina Hagen Band auf Schallplatte vorzuspielen. "Das war Punk-Musik. Man nannte sie die Mutter des deutschen Punk".
flüchtig handelt von einer Frau, die ihren Mann verlässt. Ohne Erklärung geht sie bei der Tür hinaus und kommt nicht wieder. Der Grund ihres rätselhaften Verschwindens und die Suche nach ihr stehen im Mittelpunkt des Romans anhand von Reisen, das Eintauchen in fremde Welten und in andere Perspektiven. Sein erzählender Stil liest sich leicht, vermieden werden abgenutzte Formulierungen. flüchtig wird nie fad, denn Hubert Achleitner verpackt kompakt eine Unmenge an Wissen in lebensnahe Dialoge. Alles fließt und bleibt in Bewegung - die Figuren und somit die Geschichte. Ein Roman, der in Erinnerungen wühlt und in der Gegenwart lebt. Die Zeit ist flüchtig, nicht aber diese wunderbare Erzählweise des Roman-Debütanten Hubert Achleitner.
Als Frau auf den Berg der Männer
Der Weltmusiker hat unter seinem bürgerlichen Namen Hubert Achleitner seinen ersten Roman geschrieben. In der Figur der Lisa erforscht er den "Zwang der Monogamie"
Er sitze, sagt Hubert Achleitner, gerade auf seiner Terrasse in seinem österreichischen Heimatort Bad Goisern mit Kaffee und Blick auf die Berge. Er entschuldigt sich für die Verspätung des Telefonanrufs, falsche Nummer, kann passieren. Dann erzählt der 67-Jährige, der als Hubert von Goisern als einer der wichtigsten Vertreter anspruchsvollen alpinen Sounds berühmt geworden ist, was ihn zum Debütieren als Schriftsteller getrieben hat. In seinem Roman mit dem Titel flüchtig geht es um eine Beziehung und darum, warum sie nach 30 Jahren mit einer Flucht endet. Ein Gespräch über die Werdung eines Erstlingswerks.
Herr Achleitner, wie haben Sie geschrieben? Mit Kugelschreiber, Schreibmaschine oder Laptop?
Also: mit der Schreibmaschine nicht, sonst mit allem. Sogar mit der Feder habe ich einiges geschrieben. Aber das macht oft solche Flecken. Doch letztlich war's dann der Laptop.
Wie war das Gefühl vor der leeren ersten Seite, vor dem ersten Satz? War der schon im Kopf?
Mit dem Buch habe ich ja schon vor fast zwanzig Jahren im Kopf angefangen. Da war dann doch schon einiges da.
"Maria und ich haben uns gegenseitig auf der Straße aufgelesen", lautet dieser erste Satz. Wie oft haben Sie ihn im Laufe des Schreibens geändert?
Na ja, sagen wir: Jetzt steht er schon ganz gut so da.
Sie sind als Schriftsteller ein Anfänger. Wie war das, sich ins Schreiben hineinzuarbeiten?
Die große Geschichte ergibt sich so langsam. Ich bin ja kein Wortkünstler. Das war schon in der Schule so. Letztendlich bin ich auch wegen Deutsch von der Schule geflogen. Also, ich hätte halt wiederholen müssen. Also bin ich nicht mit der Erkenntnis groß geworden, sprachlich begabt zu sein. In Deutsch ein Fünfer, das sagt alles. Im Grunde bin ich während meiner Jahre in Kanada übers Englisch zum größeren Wortschatz und so auch zum Schreiben gekommen, zunächst auf Englisch. Und übers Englische zum Schreiben in Deutsch. So hab ich auch dann meinen Wortschatz erweitert. Aufgewachsen bin ich ja mit dem Dialekt, da ist der Wortschatz schon von Haus aus reduziert. Aber ich habe immer, weil ich viel gereist bin, gerne Briefe geschrieben. So bin ich mit dem Leben in das Schreiben hineingewachsen. Auch handschriftlich.
Sie sind schon vor Ihrer Musikerkarriere viel in der Welt unterwegs gewesen. Liegt diesem Buch viel Wahrheit, Erlebtes aus dieser und späterer Zeit zu Grunde?
Paul Auster hat gesagt, ein Roman, der den Schreiber nicht beinhaltet, kann nur ein schlechtes Buch sein. Das hat mich sehr beruhigt. Und Hage Hein (Hubert Achleitners in München ansässiger Manager, Anm. d. Red.) hat einmal gesagt: In dem Buch erfährt man mehr über dich als in allen Interviews. So ein Roman ist auch wie ein Traum, unabhängig von der Geschichte etwas sehr Persönliches. Ich glaube, es war C.G. Jung, der gesagt hat: "Du bist der, der durch den Traum geht." Und so ist es in dem Roman auch. Die Fantasie kann nur aus dem schöpfen, was da ist.
Es gibt hier drei Hauptpersonen, den Lehrer Herwig, dessen Frau Maria, und eben Lisa, von der Sie schreiben, das seien eigentlich Sie. Wobei diese Lisa, also Sie, die kleinste der drei Rollen innehat. Sie könnten, wie man Sie kennt, genauso gut jede andere Person sein. Da ist der Lehrer Herwig, charmant, gut aussehend und etwas älter, beliebt bei Schülern, gebildet, aber recht introvertiert und konfliktscheu.
Und musikalisch!
Ja, natürlich. Aber auch Maria ist Ihnen nicht unähnlich. Sie ist offen für fast alles, neugierig, lebenslustig, hasst Langeweile und Routine, gerade in Lebens- und Liebesdingen, was letztlich zur Katastrophe führt. Und dann ist da eben Lisa, also die Frau, die zunächst direkt und dann indirekt einen Großteil der Geschichte erzählt, und die Sie sind. Sie scheint etwas unbedarft zu sein, unabhängig, lebensneugierig, mit feinem Gespür für schwierige Situationen. Aber eigentlich ist sie für die Geschichte unwichtig.
Ich könnte auch der Lothar sein (eine etwas unsympathische Figur). Aber eigentlich bin ich nur der Erfinder dieser Geschichte.
Im Grund geht es doch, ohne jetzt den Inhalt zu verraten, in dieser Geschichte um die große Frage: Scheitert der Mensch am Zwang zur Monogamie? Und welcher Teil des Paares lädt deswegen Schuld auf sich?
Ich glaube nicht, dass diese Beziehung an der Monogamie scheitert. Sondern jeder der beiden an sich selbst. Man muss um eine Beziehung immer wieder kämpfen. Und offensichtlich haben die beiden das übersehen. Wenn es einen Schwachpunkt gibt an dem Roman, dann den, dass ich ausgespart habe, wie es langsam zum Scheitern gekommen ist. Also das Alltagsleben, wo man dann drauf kommt: Irgendwas fehlt da. Ich bin dann gleich da wieder eingestiegen, wo es schon gebrannt hat.
Kann es sein, dass Ihr Buch, so gesehen, auch eine Art Entschuldigungsschreiben für Ihr eigenes Leben, für Ihre eigenen Beziehung ist?
Nein, nein, ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe das Buch als erstes meiner Frau zu lesen gegeben. Da habe ich mich zunächst richtig gefürchtet, dass sie mir vorwirft, solche Fantasien oder so etwas erlebt und dann einfach niedergeschrieben zu haben. Aber das war nicht so. Nein, sie fand das alles sehr in Ordnung.
Herwig ist sehr beschlagen in Sachen Musik. Sie lassen ihn sogar einen echten Musikerkollegen von Ihnen erwähnen, den Georg Ringsgwandl mit seiner alten Bearbeitung von The Wind Cries Mary, die aus den Achtzigerjahren stammt, in denen die Geschichte ja beginnt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch Sie dieses Lied von Jimi Hendrix gut singen könnten. Wie kamen Sie auf diese Idee?
Es ist nicht Herwig, sondern Maria, die ihn erwähnt. Was nun Georg Ringsgwandl angeht, so habe ich gehört, dass er auch ein Buch schreibt. Und The Wind Cries Mary ist halt eines seiner geilsten Lieder. Wir haben ja in Hage Hein den gleichen Manager, dem sagte ich: Richte dem Georg einen schönen Gruß aus, ich erwarte mir, dass ich in seinem Buch auch vorkomme.
Marias Flucht führt sie und Lisa in den Norden Griechenlands, auf die Insel Chalkidiki. Ihre Schilderungen von dort sind extrem exakt. Sie haben diese Halbinsel wohl genauer kennengelernt. Wie steht es da mit Realität und Fiktion?
Ich war ein paar Mal unten in den Achtzigerjahren. Ich liebe das Lebensgefühl. Ich war auch am Athos, wo keine Frau hindarf. So kam es mir in den Sinn, diesen Athos zum Teil des Romans zu machen und ihm literarisch eine Frau zu verpassen.
Es ist wirklich beeindruckend, an diesem Berg mit dem Schiff vorbeizufahren.
Und erst recht ihn zu besteigen und oben zu stehen.
Sie haben bisher vor allem Liedtexte zu ihren Kompositionen geschrieben. Wo liegt dieser Erfahrung nach der Unterschied zwischen solchen Versen und der Roman gewordenen Prosa?
Das ist dort ein Feilen um jeden Rhythmus in der Sprache, es muss im Songtext eine Symbiose zur Musik entstehen. Ich komponiere fast immer zuerst die Musik und suche dann einen Text dazu, der sich auch singen lässt. Es gibt ja Vokale, die passen zum Beispiel nicht zu tiefen Tönen, das "i" etwa (singt ein tiefes "i", klingt nicht gut). So gehen manche Worte nicht, obwohl sie inhaltlich gut passen würden. Das ist wie ein schweres Sudoku-Rätsel. Beim Romanschreiben ist es schon ein längerer Fluss, aber es muss eben halt auch etwas Fließendes in der Sprache sein.
Sie haben vor Jahren schon einen Ausflug in die Schauspielerei gewagt, zum Beispiel in Hölleisengretl unter der Regie von Jo Baier. Was treibt Sie, den erfolgreichen Musiker, dazu, sich in immer wieder neuen Genres beweisen zu wollen? Kommt demnächst die Malerei dazu?
Malen und Zeichnen tue ich schon ewig. Aber es muss auch ein paar Suchten geben, die privat bleiben. Doch man weiß nie, was noch kommt. Momentan bin ich in den letzten Zügen für ein neues Album. Ich bin ein Mensch, der sehr im Hier und Jetzt lebt, deswegen kann ich in diesem Hier und Jetzt mich vor allem darüber freuen, dass dies das beste Album ist, das ich je gemacht habe. Und ich freue mich schon auf die Tour mit den Musikern im nächsten Jahr, wenn alles klappt. Das Schreiben hingegen ist eine sehr einsame Arbeit. Dafür muss man sich aber auch mit niemandem absprechen.
Es ist für Debütanten ja nicht einfach, einen Verlag zu finden. Wie war das? Gab's da einen Goisern-Bonus?
Ich habe das Buch geschrieben, um es fertig zu schreiben. Ich hatte nicht vor, es an einen Verlag zu schicken, und wenn, dann unter einem Pseudonym. Ich wollte es vermeiden, dass irgendwelche Verlage sagen: "Autor Hubert von Goisern? A gmahde Wiesn." Dann dachte ich eben, Hubert Achleitner würde passen, das ist eine kleine Schwelle, da müssen sie dann drüber. Ich habe am Gedenktag der Bücherverbrennung in Salzburg einen Freund aus der Literaturszene getroffen, der mich gefragt hat: "Na Hubert, was machst du denn gerade?" Ich hab etwas herumgedruckst, bis er mir auf den Kopf zugesagt hat: "Gell, du schreibst was!" Da hab' ich es ihm dann erzählt. Er bat mich um eine Leseprobe, war begeistert und brachte mich zu Zsolnay in Wien. Das war schon eine ganz neue Welt für mich, eine, wie ich finde, sehr konservative Welt. Also im Vergleich zur Musik.
War die Arbeit mit dem Lektorat Stress für Sie?
Nein, überhaupt nicht, meine Lektorin, die war wirklich super. Die hat mich auf ein paar Ungereimtheiten hingewiesen und eine Person gestrichen. Das war's.
Dieses Buch heißt flüchtig und handelt von einer Flucht. Zu Beginn des Lesens könnte man denken, auch die Arbeit an diesem Buch könnte eine Flucht gewesen sein? So aber scheint es, dass flüchtig für Sie zur Erfüllung wurde.
Ja, genau. flüchtig war zunächst nur ein Arbeitstitel. Aber je mehr ich darüber nachgedacht hatte, wuchs das Gefühl: Das passt schon.
Kurzkritik: Flüchtig
Seit 30 Jahren leben Eva Maria Magdalena und Herwig so leidenschafts- wie sprachlos nebeneinander her. Nun ist die Bankangestellte auch noch bei einer Beförderung übergangen worden und hat in Herwigs Handy eine eindeutige SMS von einer anderen Frau gefunden. 55-jährig beschließt sie, ihr stumpfes Leben hinter sich zu lassen. Wohin sie will, weiß sie nicht. Als Herwig eines Tages von der Arbeit nach Hause kommt, ist sie jedenfalls weg. Sie sitzt im Auto gen Süden.
Hubert Achleitner erzählt in seinem ersten Roman psychologisch sensibel von einer jungen Liebe, die an einer Fehlgeburt zerbrochen ist. So wenig geschieht in der Duldungsstarre der folgenden Jahrzehnte, dass sie nicht viel Raum in der Erzählung nehmen: Sie stürzt sich in die Berge, er sich in Alkohol.
Zum gelungenen Ton trägt wohl auch bei, dass hier die Frau im Mittelpunkt steht, was den Roman schon prinzipiell davor bewahrt, zur Nabelschau eines alternden Mannes zu werden. Zwar tut sich seit Kurzem auch in Herwigs Leben wieder etwas – deshalb die SMS. Doch das Wort "vögeln", das öfters fällt, ist unverdient derb für die Beziehung zu einer Jüngeren, die Achleitner sehr liebevoll und reflektiert zeichnet.
Nach ein paar Seiten mit unnötig schwülstigen Formulierungen ("Trotz des aussichtsreichen Nistplatzes und der hoffnungsvollen Umstände rollte die Glückskugel vom Tisch", über die Fehlgeburt) erholt sich Achleitner überraschend davon und entwickelt eine elegante Erzählung in klare Worten. Die geschickt verflochtenen Handlungsstränge zwischen Österreich und Griechenland machen sie zum lebensklugen Pageturner.
"Ich habe einen Crash gefürchtet"
Mit seinen Alpinkatzen hat er den Alpenrock erfunden, jetzt veröffentlicht Hubert Achleitner mit "flüchtig" seinen ersten Roman. Und auch das neue Goisern-Album ist fertig.
Hubert Achleitner, 67 Jahre alt und bekannt als Alpin-Musiker Hubert von Goisern, sitzt in seinem zum Studio ausgebauten Arbeitsraum in Salzburg und scheint kaum gealtert zu sein. In den vergangenen Jahren befand er sich nicht wie sonst auf einer seiner Musikexpeditionen, sondern in selbstgewählter Isolation. Fast zwei Jahre hat er an seinem nun veröffentlichten ersten Roman flüchtig geschrieben. Wenn er von seiner fiktiven Reise aus dem Salzburger Land in die Mönchsrepublik Athos berichtet, die er mit seinen Romanfiguren unternommen hat, blitzen seine Augen und bisweilen legt sich ein zufriedenes Lächeln über das Gesicht. Er hat sich mit den 304 in Hardcover gebundenen Seiten einen Traum erfüllt, der ihm neue Kraft und Lust für seine musikalische Passion gegeben hat. Der Roman war noch nicht gedruckt, da ging es bereits in die Endphase des neuen Albums Zeiten & Zeichen, das, wenn Corona es zulässt, noch in diesem Sommer erscheinen soll.
Sie schlüpfen [in ihrem Roman, flüchtig,] gleich in mehrere Rollen, auch die der Erzählerin Lisa. Macht genau das den besonderen Reiz eines Romans aus?
In eine fiktive Figur hineinschlüpfen zu können, die nicht so denkt wie man selbst, ist sehr spannend. Natürlich steckt in jeder der Figuren auch etwas von mir. Ganz lässt sich das nie trennen. Ich habe mich aber so in sie hineingefühlt, dass ich respektvoll mit ihnen umgehen konnte. Es ist mir beispielsweise nicht gelungen, einen wirklich bösen Charakter zu schaffen. Etwas Böses wollte ich nicht einmal in fiktiver Form in die Welt setzen.
Wie sehr waren sie ein Getriebener Ihrer Figuren?
Das ist ein wenig so wie bei Golem. Du kämpfst lange darum, dass sich die Figuren endlich bewegen. Wenn sie dann mit Leben gefüllt und beseelt sind, haben sie natürlich auch einen eigenen Kopf und machen nicht immer das, was man gerne hätte. Was aber auch sehr schön ist. Man muss akzeptieren, dass sie einem entgleiten können, und ist bisweilen nur Beobachter. Gedanken verwandeln sich während des Schreibens, da die Worte eine ganz eigene Energie haben und sich selber ins Geschehen einbringen.
Welche Rolle spielt die Musik für das Charakterisieren der einzelnen Figuren?
Ich bin natürlich sehr geprägt von der Musik, und es gibt für alles in meinem Kopf einen Soundtrack. Musik beschreibt in sehr verdichteter Form. Vermutlich sind deshalb fast alle meine Figuren musikalisch geworden.
Wie groß war der Erfolgsdruck?
Ich hatte keine Abgabefrist eines Verlags. Nur meine Familie und meine besten Freunde wussten, dass ich schreibe. Ich habe in der Zeit konsequent nicht darüber geredet, sondern mich ganz in mich zurückgezogen. Im letzten halben Jahr des Entstehungsprozess habe ich nur geschrieben, gegessen und geschlafen.
Gab es im Schreibprozess Punkte, an denen Sie verzweifelt waren?
Ich wusste immer mal wieder nicht, wie es weitergehen soll. Im ersten Jahr habe ich während einer Schreibsperre immer zu einem Instrument gegriffen und mich locker gespielt. In dieser Zeit sind auch eine Menge Ideen entstanden, die ich jetzt für das neue Album zu Liedern gemacht habe. Im zweiten Jahr war ich nur auf das Schreiben fokussiert und habe alle Instrumente weggesperrt. Da bekam ich schon immer wieder Panik, dass ich das nicht hinbekomme und mich übernommen habe. In diesen Momenten war es wichtig, trotz aller Zweifel immer zu schreiben.
Der Roman erzählt von einem Wendepunkt und für Sie war es auch ein Sprung aus der gelebten, sehr erfolgreichen Routine.
Und ich bin lange in der Luft gehangen. Ich habe mir gesagt: Genieße die Aussicht von oben und denke nicht darüber nach, wie die Landung sein wird. Als ich dann allerdings dem Ende des Buchs entgegen kam und so viele Stränge zusammenliefen, habe ich mich vor der Landung oder dem eventuellen Crash schon gefürchtet. Gott sei Dank habe ich den Roman gut zu Boden gebracht.
Große Teile des Romans spielen in Ihrer österreichischen Heimat, aber auch in Griechenland. War da auch einiges an Recherche nötig?
Ich bin natürlich in alle Themen, die im Buch stattfinden, tiefer eingestiegen und habe viel gelesen. Sei es über das Milieu in Salzburg nach dem Krieg oder die Besatzungszeit am Athos. In den 80er Jahren wie auch in den vergangenen Jahren war ich immer wieder dort und kenne die autonome Mönchsrepublik sehr gut.
Sollte ein Roman auch ein Zeitdokument sein?
Nicht zwingend, dieser ist es natürlich schon, da er sich über drei Generationen vom Zweiten Weltkrieg bis heute durchzieht. Da wehen verschiedene Zeitgeister hindurch. Aber man hat natürlich als Autor immer auch den Anspruch, dass man etwas erschafft, was Bestand hat und zwar fernab aller modischer Tendenzen.
Fühlte sich das Musik machen für das neue Album nach dem Schreiben des Romans anders an?
Schreiben ist eine sehr introvertierte und einsame Tätigkeit, die ich sehr genossen habe. Ich habe mich dann aber auch sehr auf die Zeit danach gefreut. Auf die Kommunikation und auf das gemeinsame Musizieren.
Ist der Output für das Album deshalb so abwechslungsreich geraten?
Da hatte sich einiges aufgestaut. Bisher hatte ich mit dem Schreiben der Lieder immer speziell für ein neues Album begonnen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Ideen festzuhalten. Jetzt hatte ich das über die vergangenen vier Jahre aber doch gemacht. Wenn ich erkennen konnte, dass mir da gerade ein kreatives Geschenk gemacht wurde, habe ich die Idee skizziert oder mit dem Smartphone aufgenommen. Deshalb hatte ich sehr viel Material zur Verfügung. Meine erste Aufgabe war das Aussortieren aus 40 guten Ideen. 17 Songs sind nun geblieben und die haben wir alle für das neue Album Zeiten & Zeichen zu Ende geführt.
"Ich mag meine weiblichen Seiten"
Vor 28 Jahren machte er sich mit Koa Hiatamadl einen Namen in der österreichischen Musikbranche. Vor vier Jahren stand Hubert von Goisern, 67, das letzte Mal auf der Bühne. Jetzt ist er zurück – als Buchautor. Mit uns sprach der Künstler über Egoismus, Selbstwirklichung und Glück, das einem abhandenkommt, wenn man nichts dafür investiert.
"Telefoninterviews habe ich immer verweigert", ist einer der ersten Sätze, die bei unserem Termin mit Hubert von Goisern, 67, via "Zoom" fallen. "Ich finde, wenn man miteinander redet, soll man sich persönlich gegenübersitzen." Nachsatz: "Es ist jetzt aber halt so, wie es ist." Der Tiefe des Gesprächs ist die Distanz jedenfalls nicht abträglich. Es geht viel ums Verlieren, Weggehen, darum, sich neu zu erfinden. Themen, die das persönliche Leben des Künstlers bestimmen. Immer wieder zieht es ihn in die Ferne, am liebsten in touristisch weniger frequentierte Gebiete wie Grönland. Aber auch der Plot seines ersten Romans, flüchtig, den er unter seinem echten Namen Hubert Achleitner veröffentlicht hat, (Zsolnay Verlag, € 23,70) handelt vom Reisen, Unterwegssein, Ankommen. Die Protagonistin steigt wortlos aus ihrem Umfeld aus, kündigt ihren Job und verlässt ihren Mann, mit dem sie seit 30 Jahren verheiratet ist, um in Griechenland etwas anderes zu spüren als jene Routine, die sie seit langer Zeit erdrückt und einengt.
 Sie schreiben über ein Ehepaar, das sich im Lauf der Zeit verliert. Warum haben Sie gerade dieses Thema gewählt?
Sie schreiben über ein Ehepaar, das sich im Lauf der Zeit verliert. Warum haben Sie gerade dieses Thema gewählt?
Ich habe oft Paare beobachtet, bei denen ich mir dachte: Warum bleiben sie zusammen? Sie machen sich gegenseitig nicht schön. Damit meine ich keine äußerliche Eigenschaft, sondern eine, die durch und durch geht. Wenn das fehlt, müsste man schon mal drüber nachdenken, ob es denn nicht gescheiter wäre, aufzuhören. Sich fragen, ob man nur noch zusammen ist, weil's bequem ist oder es mit einer öffentlichen Erwartungshaltung zu tun hat. Oft wird eine Scheidung oder Trennung mit Unzuverlässigkeit assoziiert. Am spannendesten fand ich es, mich dabei in eine Frau hineinzuversetzen.
Und, wie war's?
Großartig. In der Pubertät habe ich mir immer gewünscht, eine zu sein. Ich hatte das Gefühl, es hängt alles an uns Männern. Wir müssen auf Frauen zugehen. Wäre ich ein Mädl, hab ich mir gedacht, könnte ich mich hinsetzen und darauf warten, bis einer vorbeikommt. (lacht) Inzwischen weiß ich, dass das nicht stimmt. Aber jeder von uns trägt beide Anteile in sich, und ich mag meine weiblichen Seiten.
Welche sind das?
Das Romantische. Und ich mag es, fürsorglich zu sein, anderen Menschen ein Nest zu bieten, das ihnen Sicherheit gibt. Da kann jemand sagen: Viele Männer wollen das! – Eh, aber das ist eben diese weibliche Seite in uns. So wie es auch die männlichen Anteile in Frauen gibt, wenn sie mal all das, was ich genannt habe, links liegen lassen, zielgerichtet, ichbezogen und erfolgsorientiert handeln.
Wie egoistisch darf man in Sachen Selbstverwirklichung sein?
Es ist keine Frage des Dürfens, sondern des Müssens. Viele Dinge, die man im Leben für sich umsetzen möchte, hängen vom Umfeld ab. Und es ist eine Art von Egoismus, wenn man den Anspruch stellt, dass andere einem dabei helfen, die eigenen Ideen zu verwirklichen. Es gibt viele, die das gerne machen. Auch in meinem Leben gab es Phasen, wo ich Freude daran hatte, anderen zuzuarbeiten, bis ich irgendwann gemerkt habe: Am besten bin ich, wenn ich meine Projekte verfolge.
Wie egoistisch empfinden Sie sich?
Ich glaube, ich bin egozentrisch. Einem Egoisten ist es wurscht, was links und rechts von ihm passiert. Ich bin aber ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Mir geht's nur gut, wenn es allen um mich herum auch gut geht.
Womit haben Sie Menschen schon unglücklich gemacht?
Bei meiner vorletzten Platte vor ein paar Jahren hat mir einer geschrieben, dass er von mir total enttäuscht sei, weil ich das ganze Album komplett an ihm vorbeikomponiert hätte. Zwei Jahre später schrieb er mir wieder – dieses Mal versöhnlich. Er meinte, er hätte sich jetzt so lange damit auseinandergesetzt, dass er jetzt versteht, worum's mir ging. (lacht) Das sind die lustigen Enttäuschungen. Ich habe aber ganz sicher auch Menschen traurig gemacht, weil ich nicht der war, der zu sein ich vielleicht vorgespielt habe, oder weil ich gewisse Erwartungen einfach nicht erfüllen konnte. Ich habe andere enttäuscht, weil ich nicht um sie gekämpft habe. Es braucht sehr viel Kraft, zu sagen: Ich will nicht mehr bleiben. Das nehme ich ernst, und mein erster Reflex ist: Okay, dann geh ...
Und manche von ihnen haben darauf gewartet, dass Sie sie nicht so einfach gehen lassen ...
Ja, das haben sie mir im Nachhinein, oft Jahre später, gesagt. Nachdem ich selbst sehr egozentrisch bin, respektiere ich das auch bei anderen. Man kann drüber reden, aber ich überrede niemanden zu etwas. Vielleicht auch, weil ich den damit verbundenen Prozess, sich neu zu erfinden, von mir selbst kenne. Das gelingt nur, wenn man weggeht. Ansonsten ist man immer allen Projektionen ausgesetzt, die einem das Umfeld umhängt.
Aber nimmt man die nicht überallhin mit, weil man sie im Kopf hat?
Kann man, muss man aber nicht. Wenn man bleibt und sich von diesen Projektionen befreien will, kämpft man gegen Windmühlen. Was
die Leute einem zuschreiben, wird man kaum los. Wenn du weggehst, nimmst du wirklich nur das mit, was dich ausmacht. Du kannst ausprobieren, ein anderer zu sein, und schauen, ob es funktioniert oder ob du vielleicht eh so bist, wie alle sagen.
Sie schreiben über etwas, wovon viele träumen: den großen Ausstieg aus dem Hamsterrad. Sind die Bedenken, die uns meist daran hindern, Ausreden oder berechtigt?
Was uns aufhält, ist oft die Bequemlichkeit. Das ist etwas, das nicht sein müsste. Was durchaus einen Sinn ergibt, ist unser Sicherheitsdenken. Das ist tief eingegraben in unsere DNA. Außerdem sind wir auch einem gesellschaftlichen Druck ausgesetzt. Wenn einer ausbricht, wird er schnell gedisst, und wer will das schon. Ich glaube aber, es ginge sich für die meisten Leute mehr aus als sie sich zutrauen.
Welcher Ihrer Wünsche ist noch unerfüllt?
Es gibt Fantasien, die ich schon seit 30 Jahren mit mir herumtrage. Eine Oper zu schreiben, zum Beispiel. Oder eine Messe. Ich bin zwar aus der katholischen Kirche ausgetreten, bin aber immer gern in Messen gegangen. Chor, Weihrauch, Orgelspiel – ich find das einfach geil. Nur leider schüttet es mir spätestens bei der Predigt immer das Kraut raus. Ich fand's auf Lateinisch am tollsten, weil da holt einen die Fragwürdigkeit mancher Texte und Gebete nicht so schnell ein. Allein schon das "Vater unser" – das ist ein ziemlich kastrierter Gott, wenn er nur das männliche Prinzip verkörpert. Mir geht's dabei nicht um Schöpfergeschichte, Moral, Ethik. Religion ist in erster Linie das Gefühl einer Zugehörigkeit. Dazu gehört Atheismus genauso wie Musik und Traditionen, die wir pflegen. Wahrscheinlich ist es auch eine Religion, Österreicher sein.
Liegt's in der Natur mancher Beziehungen, dass sie sich abnutzen, oder hat es immer aktiv etwas mit uns zu tun?
Es gibt Begegnungen, die sind eine Zeit lang toll, und irgendwann braucht man einander nicht mehr. Da hilft es nichts, wenn man daran festhält. Aber auch in Beziehungen, die lange halten, muss man sich immer wieder um ihre Erneuerung bemühen und sich den Grund vergegenwärtigen, warum man zusammen ist. An seinem Glück muss man stetig arbeiten. Auch am gemeinsamen. Das kann man nicht als gegeben hinnehmen, man muss dafür auch was investieren. Und man sollte handeln, auch wenn es sich dann vielleicht als Irrtum herausstellt. Blöd ist es, wenn man nichts tut und jahrelang mit dem Gefühl lebt, dass es eigentlich nichts mehr ist.
Was ist wichtig in einer Partnerschaft?
Dass jeder sein eigenes Leben hat. Es gibt Leute, die damit glücklich werden, wenn sie mit ihrem Partner zu einer untrennbaren Einheit verwachsen. Aber ich denke, das sollte grundsätzlich nicht der Anspruch sein. Das Rot, das ich sehe, ist ein anderes als das, das Sie sehen, und wir bilden uns nur ein, es sei dieselbe Farbe. Wir sind alle verschieden, und diesen Umstand sollten wir leben können. Wir sollten uns bewusst machen, dass wir alle eine Insel sind, und was für ein unglaubliches Glück es ist, die der anderen betreten zu dürfen. Ich glaube, die Corona-Zeit war eine große Chance für viele, darüber nachzudenken, was uns verbindet. Das ist bedeutender als die Tatsache, dass wir nicht hinausdurften.
Ihr kommendes Album klingt wieder ganz anders als Ihr letztes. Wie schaffen Sie es nach so langer Zeit, sich immer wieder neu zu erfinden?
Ich nehme mir lange Auszeiten. Das letzte Mal stand ich am 26. Oktober 2016 auf der Bühne. Danach habe ich mich ein Jahr lang zurückgezogen. Ich habe nicht mal drüber nachgedacht, was ich machen möchte. Ich spiele in solchen Phasen auch keine Instrumente.
Was machen Sie dann?
Ich gehe schwimmen, Ski fahren oder arbeite in der Werkstatt und repariere Dinge. Handwerkliches taugt mir sehr. Wenn ich richtig busy bin, muss ich es delegieren und habe immer ein schlechtes Gewissen dabei.
Wann haben Sie dieses sonst noch?
Wenn ich nichts tue. Ich sehne mich nach Faulheit. Das habe ich vielleicht von meinem Vater. Er ist 92 und leidet total darunter, dass er mit dem Alter nicht mehr so hackeln kann wie früher. Für uns alle ist es eine Bereicherung, wenn er da sitzt und Geschichten erzählt. Ihm aber fehlt das Tun. Ich hoffe, ich kriege das früher als er in den Griff.
Sie sind viel unterwegs. Was war Ihre schönste Reise?
Meistens ist es die letzte, also nach Grönland. Ich war jetzt schon zum vierten oder fünften Mal dort. Ich mag die Großartigkeit der Natur, diese Leere und Kargheit, wo man sich selbst spüren kann. Man sieht, wie wenig man braucht, um ein wunderbares Lebensgefühl zu haben. Was mich antreibt, ist die Neugier. Ich will wissen, wie das Leben anderswo funktioniert. Was ich dabei erkannt habe, ist, dass Menschen überall gleich sind. Wir alle haben dieselben Träume, Bedürfnisse und Ängste. Wenn man zum Kern vorstoßen möchte, braucht man nirgendwohin zu fahren – man muss nur in sich selbst hineinschauen.
Hubert Achleitner: Flüchtig
Marias und Herwigs Ehe ist an einem jahrelangen Gleichmut, nach einer Fehlgeburt von Maria und dem Wissen, nie wieder Kinder bekommen zu können, zerschlissen. In dieser Situation erfährt Maria unter dem Pseudonym "Nordlicht" am Handy ihres Ehemannes dass "eine" Nora (von ihm?) schwanger ist. Sie beschließt dem Glück ihres "Noch-Ehemanns" nicht im Wege zu stehen und macht sich auf einen neuen Weg, indem sie die Flucht ergreift.
Dieser Fluchtweg führt in erster Linie zu sich selbst – und zu Menschen, die ihr Wege zum elementaren "Innern Ich" aufzeigen. Der Autor, bisher vielen Menschen durch seine einfühlsame Musik bekannt, versteht es meisterhaft mit Worten zu spielen. Mit viel Einfühlungsvermögen nimmt er in diesem Roman eine weibliche Position ein, aus deren Sicht er die Welt beschreibt. Menschen, die den Weg von Maria säumen, werden mit einer kurzen Lebensbeschreibung vorgestellt und somit aus der Anonymität geholt. Wer sich auf diese Art des Schreibens einlässt, schafft es fast nicht, das Buch wegzulegen, bevor es zu Ende gelesen ist.